Einleitung: Gnade allein
Mein Leben ist keine Erfolgsgeschichte, sondern eine Geschichte der Gnade Jesu Christi. Alles, was ich bin und habe, verdanke ich allein der unermesslichen Barmherzigkeit Gottes. Ohne Ihn wäre ich verloren, doch Christus hat mich gesucht und gefunden.
Wenn ich von Gottes Wirken in meinem Leben erzählen darf, möchte ich ganz am Anfang beginnen – bei meiner Herkunft und den Umständen, in denen ich aufgewachsen bin. Denn gerade in diesem Rückblick wird deutlich: Errettung ist niemals Menschenwerk, sondern immer ein Werk göttlicher Barmherzigkeit.
Die Bibel sagt es unmissverständlich: »Aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch – Gottes Gabe ist es; nicht aus Werken, damit niemand sich rühme« (Eph. 2,8-9). Kein Mensch kann sich den Himmel verdienen. Weder Herkunft noch gute Taten, weder Frömmigkeit noch Religiosität machen uns fähig, vor Gott bestehen zu können. Erlösung ist und bleibt allein Gottes Geschenk.
Und zugleich gilt: Niemand ist zu tief gefallen, niemand zu verstrickt in Schuld und Sünde, als dass Gottes Hand ihn nicht erreichen könnte. Sein Erbarmen reicht weiter als jede Schuld, tiefer als jeder Abgrund. Jede Bekehrung ist darum ein lebendiges Zeugnis Seiner Liebe, Seiner Geduld und Seiner unendlichen Gnade – und auch mein Leben zeugt davon.
Darum möchte ich erzählen, wie der Herr mich geführt, getragen und schließlich errettet hat. Nicht um mich selbst ins Licht zu stellen, sondern um Ihn zu verherrlichen.
Herkunft und Kindheit in Sibirien
Mein Name ist Niko Derksen. Ich bin das zweitjüngste von neun Kindern und wuchs mit meinen Eltern und meinen acht Geschwistern in Sibirien auf – in einer Zeit, in der der Kommunismus das ganze Leben bestimmte.
Als Deutsche in der damaligen Sowjetunion gehörten wir zu einer verachteten Minderheit. Schon früh erlebte ich Misstrauen, Spott und Hass. Für viele Menschen war allein unsere Herkunft Grund genug, uns zu beleidigen. Häufig wurde ich als »Faschist« oder »Hitlerjunge« beschimpft. Für ein Kind war das eine schwere Last, und doch war es Teil des Weges, den Gott für mich vorgesehen hat.
Schon in den ersten Monaten meines Lebens zeigte sich, wie sehr ich von Gottes Bewahrung abhängig war. Als ich als Baby eines Abends zuhause im Kinderwagen lag, warfen wütende Menschen Steine durch unser Fenster. Doch keiner traf mich. Meine Eltern waren erschüttert über den Hass und zugleich voller Dankbarkeit gegenüber Gott, dass Er mich verschont hatte. So erlebten wir schon ganz am Anfang meines Lebens, was der Psalmist bekennt: »Der HERR ist gnädig und gerecht, ja, unser Gott ist barmherzig. Der HERR behütet die Einfältigen« (Ps. 116,5-6).
Zu dieser allgemeinen Ablehnung aufgrund unserer Herkunft kam der Hass hinzu, den wir alle als Christen erfuhren. Wer dem Kommunismus und seiner atheistischen Ideologie nicht folgen konnte, wurde ausgegrenzt. Ein Christ zu sein bedeutete dort, dass man Spott, Benachteiligung und Diskriminierung erleben musste.
Für mich als Kind war besonders die Schule ein Ort der Qual. Schon die Bewältigung des Weges dorthin war mit Angst verbunden. An der Bushaltestelle, im Bus, und dann im Klassenzimmer – überall erwarteten mich Demütigungen. Lehrer stellten mich vor der ganzen Klasse bloß, Schüler lachten mich aus. Gute Noten bekam ich kaum – egal wie sehr ich mich bemühte. Es war, als wäre über mein Leben schon das Urteil gesprochen.
Als ich etwa neun Jahre alt war, sollten alle Schüler feierlich ein Abzeichen erhalten – einen roten Stern mit dem Porträt des kleinen Lenin, auch »Lenins Kinderporträt« genannt. In der Schule wurde dazu eine kleine Zeremonie veranstaltet, mit einem großen Lenin-Bild und einer feierlichen Ansprache. Als Kinder sollten wir ein Gelöbnis aufsagen, Lenin und dem Kommunismus treu zu sein. Dieses Abzeichen sollten wir von nun an jeden Tag sichtbar an unserer Schuluniform tragen.
Die ganze Klasse nahm daran teil. Als ich dazu aufgerufen wurde, dieses Versprechen vor dem Bild Lenins abzulegen, verweigerte ich es. Die Lehrer akzeptierten das nicht. Man zerrte mich gewaltsam nach vorne, zwei Mitschüler hielten mich fest, und eine Lehrerin steckte mir das Sternchen auf die Brust. Die Klasse jubelte und applaudierte.
Doch ich fühlte mich in diesem Moment wie ein Verräter gegenüber Gott. Noch während der Feier riss ich den Stern wieder ab und warf ihn zum Fenster hinaus. Die Lehrerin wurde zornig: »Wie kannst du nur so etwas Respektloses tun?!« Ich antwortete: »Wenn ihr euren Kommunismus nur mit Gewalt jemandem aufzwingen könnt, dann ist er nicht viel wert.«
Zur Strafe musste ich eine Woche lang nach dem Unterrichtsschluss die ganze Klasse durchwischen. Da ich mich auch dagegen wehrte, wurde die Strafe verlängert: Drei Wochen lang musste ich den Klassenraum putzen.
Doch nicht nur in der Schule begegnete mir Widerstand. Selbst alltägliche Dinge wie das Einkaufen gestalteten sich als eine Art Prüfung. Ich erinnere mich an Tage, an denen mir im Laden das Brot verweigert wurde – nicht etwa, weil keines da war, sondern weil ich ein Deutscher war und aus einer christlichen Familie stammte. Solche Erfahrungen brannten sich tief in meine Seele ein.
Und doch – bei all dem Schmerz lag über meinem Leben die unsichtbare Hand Gottes. Er ließ es zu, dass ich all das Böse erlebte, aber dennoch wachte Er über mir. So lernte ich schon früh, dass die Welt voller Ungerechtigkeit ist und dass Gottes bewahrende Hand stärker ist und bleibt als die Bosheit der Menschen. Meine Mutter erinnerte uns Kinder oft an Joseph, der in Ägypten zu seinen Brüdern sagte: »Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun; aber Gott gedachte es gut zu machen« (1.Mo. 50,20). Diese Worte prägten unser Zuhause. Wir wurden angewiesen, nicht zu hassen, sondern zu vergeben. Wir sollten lernen, auch in der Erfahrung von Ablehnung die gute Hand Gottes zu erkennen.
Aufwachsen im Schatten von Verfolgung
Sowohl meine Urgroßeltern als auch meine Großeltern und Eltern waren aufrichtige Christen. Ich durfte in eine gottesfürchtige, liebevolle Familie hineingeboren werden, in der der Glaube an den lebendigen Gott das Zuhause prägte – auch wenn dieser Glaube draußen in der Gesellschaft verachtet und bekämpft wurde.
Als ich zur Welt kam, herrschte in Russland eine Zeit massiver Christenverfolgung. Öffentliche Gottesdienste waren verboten, und wer den Glauben ernst nahm und demgemäß lebte, musste bereit sein zu leiden. Viele Versammlungen fanden im Verborgenen statt: Es gab heimliche Taufen am See (manchmal in der Nacht), Bibelstunden in Privathäusern, Gebetstreffen in der Nacht.
Weil man uns staatlicherseits diesbezüglich verdächtigte, wurde ich eines Tages während des Unterrichts zum Direktor gerufen. Er saß im Büro, mitsamt seiner Stellvertreterin und zweier Männer in Zivilkleidung – Vertreter des KGB. Zunächst begannen sie, mir scheinbar harmlose Fragen zu stellen, über meine Familie, meine Eltern und Geschwister. Dann wollten sie wissen, ob wir Kontakte nach Deutschland hätten. Bis dahin antwortete ich noch und erwähnte, dass ich eine Schwester in Deutschland hätte, aber dort sonst niemanden kannte.
Doch dann wurden die Fragen ernster: Sie wollten wissen, wann und wo unsere Gottesdienste stattfänden, wer sie leite und wer für die Sonntagsschule verantwortlich sei. In diesem Moment erinnerte ich mich an das, was meine Eltern uns eingeschärft hatten: »Solche Dinge dürft ihr niemals verraten, sonst könnten Geschwister verhaftet und ins Gefängnis gebracht werden!«
Mein Herz pochte heftig, und meine Hände zitterten. Mit stockender Stimme brachte ich nur hervor: »Ich werde euch nichts sagen.« Daraufhin begannen sie mit Drohungen und Einschüchterungen. Sie sagten, meine Eltern würden ins Gefängnis kommen und wir Kinder ins Heim, wenn ich weiter schweige. Ich zitterte am ganzen Körper, mir liefen die Tränen herunter, doch ich schwieg – aus Angst, aber auch, weil ich wusste: Schweigen bedeutete, die Gläubigen zu schützen.
Ich war sicher kein Held – im Gegenteil: In meinem Herzen hielt ich mich für einen Feigling, weil ich gezittert und geweint hatte. Doch als ich nach Hause kam und meiner Mama alles erzählte, nahm sie mich in den Arm, tröstete mich und betete mit mir, dass wir als Kinder standhaft und mutig bleiben mögen.
Die Vermutung des Geheimdienstes traf zu: In unserem Haus fanden tatsächlich Gottesdienste und Sonntagsschulstunden statt. Vielleicht wussten sie es auch. Immer wieder räumten wir Zimmer aus, um Platz zu schaffen für Glaubensgeschwister, die miteinander das Wort Gottes hören, beten und das Mahl des Herrn feiern wollten. Ich erinnere mich gern an diese Versammlungen – sie waren geprägt von tiefer Freude, aber auch von Ernst und heiliger Ehrfurcht.
Oft blieben sie jedoch nicht ungestört. Manchmal haben uns gewisse Nachbarn verraten, woraufhin die Polizei während des Gottesdienstes in unser Haus stürmte. Meinem Vater wurden Strafen auferlegt, weil er es erlaubte, dass der Gottesdienst bei uns zu Hause stattfand. Manche Prediger wurden verhört und sogar verhaftet. Unser Haus wurde überwacht, unsere Schritte kontrolliert. Es war ein Leben, das ständig von der Gefahr überschattet war, entdeckt und bestraft zu werden.
In alledem erlebten wir jedoch Gottes mächtige Treue. Trotz der Drohungen, Strafen und Verhöre konnte niemand verhindern, dass Gottes Wort verkündet wurde und die Gemeinde wuchs. Das Leben der Apostel wurde für uns lebendige Realität; auch sie bezeugten in ihren Tagen: »Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen« (Apg. 5,29). Diese Haltung prägte meine Eltern und sie prägte schon früh auch mein Herz.
Geheime Gemeindearbeit zu Hause
Wir lebten in einer Atmosphäre des Schweigens und der Vorsicht. Schon als Kinder mussten wir lernen, keine Informationen über Besucher oder Versammlungen preiszugeben. Jedes unbedachte Wort konnte Gefahr nach sich ziehen.
Oft beherbergten wir in unserem Haus Pastoren aus anderen Gemeinden. Viele wurden bereits von der Geheimpolizei gesucht, manche mit Haftbefehl, weil sie trotz aller Verbote das Evangelium verkündigten und die Untergrundgemeinden stärkten. Ihr mutiges Zeugnis hat mein Leben tief geprägt.
Für uns Kinder war es beklemmend zu wissen, dass unter unserem Dach Männer wohnten, die jederzeit verhaftet werden konnten. Zugleich erkannten wir aber etwas von der heiligen Ernsthaftigkeit dieser Zeit. Es war, als hätten wir Anteil an dem gleichen Kampf, den schon die ersten Christen führten. Diese Männer liebten ihr Leben nicht, sogar bis zum Tod (s. Off. 12,11), sondern waren bereit, um Christi willen alles zu verlieren.
Immer wieder durften wir erleben, wie Gott sie wunderbar bewahrte. Manche entgingen nur knapp einer Verhaftung, andere konnten trotz großer Gefahr weiterreisen, um das Wort Gottes zu verkünden. So erfuhren wir, dass das Wachstum von Gottes Reich durch Mauern, Gefängnisse oder Geheimdienste nicht aufzuhalten ist. Jesus Selbst hatte es verheißen: »Ich will Meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen« (Mt. 16,18). Genau das durften wir erleben – mitten in Verfolgung, Bedrohung und Angst.
Auch Missionare und Glaubensgeschwister, die in geheimen Druckereien tätig waren, fanden in unserem Haus immer wieder Zuflucht. Einige wurden von der Geheimpolizei gesucht, weil sie trotz aller Drohungen das Evangelium weitertrugen. So wurde unser Zuhause nicht nur ein Ort der Gemeinschaft, sondern ein kleiner Hafen für Diener Christi, die in ständiger Gefahr lebten.
Ein besonderer Teil des Dienstes meiner Eltern war unsere eigene, schlicht ausgestattete Geheimdruckerei. Meist in der Nacht, wenn die kleinen Kinder schliefen, entstanden dort mit einfachsten Mitteln christliche Bücher: Predigtbände, Liederbücher, Biografien und andere erbauliche Schriften. Sie wurden von Hand geschrieben, vervielfältigt und zusammengeheftet – ein mühsames und zugleich gefährliches Unterfangen.
In jenen Jahren war es fast unmöglich, Bibeln oder christliche Literatur zu bekommen. Der Kommunismus wollte die Stimme Gottes zum Schweigen bringen, indem er den Gebrauch und die Verbreitung Seines Wortes unterdrückte. Doch genau dadurch wuchs der Eifer, Bibeln selbst herzustellen und weiterzugeben – koste es, was es wolle, und sei es mit primitivsten Werkzeugen und unter größter Gefahr. Für meine Eltern und älteren Geschwister bedeutete dies ein hohes Risiko: Die Entdeckung dieser Tätigkeit hätte Gefängnis, Zwangsarbeit und Trennung von der Familie bedeutet.
Aber sie hielten fest an der Wahrheit, die schon Paulus bezeugte: »Das Wort Gottes ist nicht gekettet« (2.Tim. 2,9). Während wir Kinder schliefen, wurde in der Stille der Nacht Samen ausgesät, der für viele Christen in Russland zu einer geistlichen Lebensquelle wurde. Heute erkenne ich: Diese unscheinbare Arbeit im Verborgenen war ein Teil von Gottes großem Plan, Sein Reich zu bauen und ich durfte schon als Kind etwas davon miterleben.
Das geistliche Erbe der Eltern
Ich habe großen Respekt vor meinen Eltern. Ihre Liebe zu Christus und ihre unerschütterliche Hingabe haben mein Leben tief geprägt. Sie lebten mir vor, was es heißt, Jesu Wort ernst zu nehmen: »Wer sein Leben findet, wird es verlieren; und wer sein Leben verliert um Meinetwillen, der wird es finden« (Mt. 10,39). Für sie war der Glaube keine Nebensache, sondern der Mittelpunkt ihres ganzen Lebens.
Sie waren bereit, alles für den Herrn hinzugeben: ihr Haus, ihr Geld, ihre Zeit, ihre Gaben – ja, ihr ganzes Leben. Sie wussten, dass wahre Nachfolge unweigerlich mit Leiden verbunden ist, und sie nahmen es willig auf sich. Ob Strafen, Demütigungen oder die ständige Gefahr einer Verhaftung – sie ließen sich nicht erschüttern, sondern hielten fest an Christus und an der Gemeinde. Tief in ihrem Herzen waren sie überzeugt: Kein Opfer ist zu groß für den Einen, der Sein Leben am Kreuz für uns hingegeben hat.
Besonders mein Vater ist mir bis heute ein großes Vorbild. Mit seiner ruhigen, sanften und hingebungsvollen Art lebte er das aus, was er glaubte – nicht laut und prahlerisch, sondern treu, beständig und voller Vertrauen auf Christus. Gerade in seiner stillen Zurückhaltung offenbarte sich eine innere Stärke, die allein aus der Gemeinschaft mit dem Herrn erwuchs.
Wenn ich heute zurückblicke, erkenne ich: Das kostbarste Erbe, das mir meine Eltern hinterlassen haben, war nicht materieller Besitz oder weltlicher Erfolg, sondern ihr lebendiges Zeugnis für Christus. Ihr Glaube war aufrichtig, ihr Leben dem Herrn geweiht, und durch ihr Vorbild durfte ich schon früh lernen, dass wahre Nachfolge darin besteht, Sein Kreuz auf sich zu nehmen und dem Herrn nachzufolgen.
Meine innere Leere trotz christlicher Erziehung
Obwohl ich in einer gottesfürchtigen Familie aufwuchs, schon früh so viel aus der Bibel lernte und auch wusste, dass ich ein neues Herz brauche, war ich dennoch verloren. Christliche Erziehung macht noch keinen zum Christen. Ich kannte viele Wahrheiten des Evangeliums, aber mein eigenes Herz war noch nicht erneuert.
Statt Freude am Gehorsam, prägten Stolz, Ungehorsam und Rebellion mein Leben. Ich bewunderte Männer wie Joseph, Daniel oder David und dachte oft: »Wenn ich mich nur genug anstrenge, könnte ich auch so werden.« Aber ich erkannte nicht, dass all meine eigenen Bemühungen vergeblich waren. Ich verstand nicht die entscheidende Wahrheit des Evangeliums: Der Mensch kann sich nicht selbst verändern, und die Gnade lässt sich nicht verdienen. »Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor Ihm gerechtfertigt werden kann« (Röm. 3,20).
So versuchte ich, durch meine guten Werke sowohl Gott als auch Menschen zu beeindrucken, um die Anerkennung meiner Eltern, Geschwister und der Gemeinde zu gewinnen. Aber innerlich blieb ich leer. Meine Werke konnten die Schuld nicht tilgen und die Leere nicht füllen. Ich lebte nicht aus Gnade, sondern aus dem vergeblichen Versuch eigener Anstrengung.
Schon als Kind hatte ich eine besondere Liebe zu Musik, Kunst und kreativem Gestalten. Ich konnte stundenlang malen, basteln oder etwas Neues erfinden und hatte Freude daran, meine Gedanken und Ideen auf diese Weise auszudrücken. Als ich zehn Jahre alt war, beschlossen meine Eltern, mich in die Musikschule zu schicken, damit ich Klavier spielen lernte.
Bereits zu Beginn fühlte ich eine gewisse Ablehnung seitens meiner Klavierlehrerin. Einmal fragte sie mich spöttisch: »Warum willst du überhaupt Klavier spielen? Du willst kein Kommunist sein, aber trotzdem Klavier spielen?!« Für sie war alles, auch Musik, untrennbar mit der kommunistischen Ideologie verbunden. Dass ich ausgerechnet christliche Lieder spielen wollte, empfand sie als Provokation. Auch unter den anderen Schülern in der Musikschule war ich ein Außenseiter: Als einziger Junge im Klavierunterricht, wurde ich ständig verspottet: »Klavier ist doch nur etwas für Mädchen!« So wurde auch dieser Ort für mich zur Last, ohne Freude und Motivation.
Viel lieber hätte ich mich der Kunst gewidmet – dem Malen, Basteln oder Erfinden neuer Dinge. Darin fand ich mehr Freude. Doch heute erkenne ich auch in dieser Führung die gute Hand Gottes: Er hatte mir Gaben und Interessen geschenkt, die Er zu Seiner Zeit für Seinen Dienst gebrauchen wollte.
Verletzungen und Bitterkeit
So wuchs ich also auf: Auf der einen Seite durfte ich in einer christlichen, harmonischen Familie leben – geprägt von Gebet, gegenseitiger Fürsorge und einem tiefen Vertrauen auf Gott. Zuhause erlebte ich Wärme, Sicherheit und die Ausrichtung auf Christus. Doch sobald ich das Haus verließ, änderte sich das Bild. In der Schule und in der Gesellschaft begegneten mir Ablehnung und Spott. Wegen meiner Herkunft wurde ich verspottet, manchmal geschlagen und als Außenseiter behandelt. Für ein Kind war diese Feindseligkeit schwer zu ertragen.
Mit der Zeit wuchs in mir etwas Neues heran – doch es war nichts Gutes: Hass und Resignation breiteten sich aus. Ich verstand immer weniger, warum ich so sehr verachtet wurde. Bitterkeit füllte mein Herz. Ich wusste zwar, dass Jesus Frieden schenken konnte – doch ich selbst besaß diesen Frieden nicht. In meinem Herzen fühlte ich Schuld, Schmerz und innere Leere.
Mit zwölf Jahren wurde mir zum ersten Mal bewusst, wie böse mein Herz in Wirklichkeit war. Schon früh hatte ich viel aus der Bibel gehört. Ich wusste, dass alle Menschen Sünder sind und von Gott dazu aufgerufen werden, Buße zu tun und an das Evangelium zu glauben. So begann ich schließlich, zu beten; ich bat Jesus, mein Herz zu verändern.
Ein ehrlicher Wunsch war in mir erwacht: anders zu werden – liebevoller, gehorsamer. Ich versuchte, Dinge in Ordnung zu bringen, bei denen ich andere verletzt hatte. Und tatsächlich schien es für kurze Zeit, als würde sich etwas ändern. Doch meine guten Vorsätze hielten nicht lange an. Schon bald verfiel ich wieder in alte Muster und musste erkennen, dass es nicht besser mit mir wurde, sondern noch schlimmer.
Die ständigen Verletzungen durch Spott, Ignoranz und Demütigungen in der Schule ließen mein Herz immer härter werden. So lebte ich damals in einem ständigen inneren Kampf: Auf der einen Seite der Wunsch nach Veränderung, auf der anderen Seite die bittere Erfahrung, dass meine Kraft nicht ausreichte. Je mehr ich es versuchte, desto deutlicher erkannte ich meine Hilflosigkeit. In meinem Inneren entstand ein dunkler Strom aus Verbitterung, Angst und Hass, der mein Leben immer stärker bestimmte.
Eines Tages kam es in der Schule zu einem Vorfall, der mir bis heute lebendig in Erinnerung geblieben ist. Ein Klassenkamerad verhöhnte mich wieder einmal und rief spöttisch: »Faschisten sollen raus!« – Worte, die ich schon unzählige Male gehört hatte, die aber an diesem Tag etwas in mir zerbrechen ließen.
In unkontrollierbarer Wut stürzte ich mich auf ihn. Ich schlug auf ihn ein, bis er am Boden lag. Ich weiß nicht, wie weit mich meine Wut gebracht hätte, wenn der Lehrer nicht eingegriffen hätte. Viele Schüler standen dabei und beobachteten die Szene.
Zum ersten Mal brach sich die Wut Bahn, die so lange in mir geschlummert hatte. Ich erschrak über mich selbst, und zugleich spürte ich eine gefährliche Befriedigung. Es war, als hätte ich durch Gewalt ein Stück von dem zurückgewonnen, was mir über die Jahre durch Spott und Demütigung genommen worden war.
Von diesem Tag an begegneten mir manche Mitschüler mit Respekt, andere sogar mit Angst. Und in mir wuchs ein trügerischer Gedanke: Vielleicht ist das der Weg. Respekt muss man sich erkämpfen. Die Bitterkeit vermischte sich mit Stolz, und ich begann zu glauben, dass Stärke und Gewalt der Schlüssel zur Anerkennung seien.
Doch was ich damals nicht verstand, war das, was Jakobus so treffend beschreibt: »Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit!« (Jak. 1,20). Mein Zornesausbruch hatte mir vielleicht äußerlich Respekt eingebracht, aber innerlich entfremdete er mich nur noch mehr von Gott. Statt Herzensfrieden erlebte ich, wie die Sünde immer mehr Macht über mein Herz gewann.
Eine besondere Nachricht
Nach einigen Monaten traf eine Nachricht ein, die unser Leben für immer verändern sollte. Eines Abends riefen uns meine Eltern zusammen und sagten: »Kinder, wir werden Russland verlassen und nach Deutschland umziehen. Wir haben endlich die Erlaubnis bekommen, auswandern zu dürfen!«
Ich werde nie vergessen, wie meine Mutter uns ansah, mit Tränen in den Augen, und sagte: »Bald ist es vorbei mit der Christenverfolgung, mit all den Schikanen, an denen wir so schwer zu tragen hatten. Gott hat unsere Gebete erhört! Wir dürfen als Deutsche zurückkehren in die Heimat unserer Vorfahren.«
Für uns Kinder war diese Nachricht überwältigend. Jahrelang hatten wir gebetet und gehofft und nun öffnete sich die Tür. Einerseits war es wie ein Traum – endlich frei, endlich ohne Angst vor Spott, Überwachung und Diskriminierung zu leben! Ich stellte mir ein neues Leben vor, voller wunderbarer Möglichkeiten und ohne die ständige Last der Verachtung.
Als meine Lehrerin davon erfuhr, sagte sie zu mir: »Es tut mir leid, dass ich dir das Leben oft so schwer gemacht habe. Denke an mich, wenn es euch dort in Deutschland gut geht.« Ich musste noch lange darüber nachdenken. Das war ein überraschend freundliches Abschiedsgespräch – und doch sollte es nicht unser letztes Gespräch bleiben.
Nicht alles, was ich »drüben« erlebt hatte, war negativ – im Gegenteil: Es gab vieles, wofür ich von Herzen dankbar bin. Besonders prägend waren die Freundschaften in der Gemeinde, die Sonntagsschule und die Begegnungen mit anderen christlichen Familien in verschiedenen Städten. Ebenso durfte ich wertvolle Erfahrungen sammeln, als wir manchen älteren Gläubigen praktisch zur Seite standen – sei es beim Umgraben des Gartens, beim Kartoffelaussäen und -ernten, beim Vorbereiten des Holzes für den Winter oder auch bei Haus- und Umbauarbeiten. All diese Dienste, Kontakte und Gemeinschaften haben mein Leben nachhaltig geprägt und mir vor Augen geführt, wie kostbar die christliche Gemeinschaft ist, in der man einander trägt, ermutigt und füreinander da ist.
Darum mischten sich jetzt bei uns Freude und Traurigkeit. Der Gedanke, unsere Heimat, die Freunde in der Gemeinde und die geliebten Verwandten zurückzulassen, machte mir echt das Herz schwer. Alles, was bisher vertraut und auch kostbar war, lag ebenfalls in Russland und nun sollte es für immer hinter mir bleiben. So war dieser Moment voller Spannung: einerseits Hoffnung und Vorfreude auf ein neues Leben in Deutschland, aber andererseits auch Unsicherheit, Trauer und Angst vor dem Unbekannten. Meine Eltern hielten fest an dem Vertrauen, dass Gott uns führt.
Der Umzug nach Deutschland
So begann ein ganz neues Kapitel meines Lebens. Wir kamen nach Deutschland, in das Land meiner Vorfahren. Meine älteste Schwester und ihr Mann waren bereits sieben Jahre vor uns ausgewandert. Sie waren für die erste Zeit meine einzigen Bezugspersonen. Doch schon bald spürte ich, wie fremd mir dieses Land war. Wir waren unter Russen aufgewachsen, ich verstand kaum Deutsch, denn zu Hause sprachen wir ausschließlich Russisch. Nur meine Großmutter hatte Deutsch gesprochen und besaß eine alte Lutherbibel. So blieben mir Sprache, Kultur und Menschen zunächst fremd und ungewohnt.
Auch für die Schule fehlte mir jede Motivation. Ich verstand nur wenig, fand keine Freunde, und die ganze Umgebung erschien mir kalt, unnahbar und abweisend.
Schon in den ersten Schultagen traf mich eine bittere Erfahrung: Wieder wurde ich ausgelacht. Doch diesmal nicht mehr als Deutscher, sondern als »Russe«, wie ich hier bezeichnet wurde. In Russland war ich der »deutsche Faschist«, und hier in Deutschland plötzlich »der Russe«. Sogar in der Gemeinde, die wir nun besuchten, spürte ich die Distanz. Ich war der Fremde, der nicht so recht dazugehörte. Wo war nun mein Platz? Wo gehörte ich eigentlich hin? Ich fühlte mich entwurzelt, heimatlos, ohne Anerkennung.
Mit Wucht brachen die ganze alte Wut und Bitterkeit wieder auf. Frust, innere Leere und dunkle Gedanken fraßen an meiner Seele. Manchmal konnte ich allein den Gedanken, wieder in die Schule gehen zu müssen, kaum ertragen. Fast jeden Morgen gab sich meine Mutter die größte Mühe, mich dazu zu motivieren, indem sie mich liebevoll, aber eindringlich drängte: »Niko, geh zur Schule. Gib nicht auf! Es wird schon alles besser werden.« Ich fühlte mich wie ein Schiff ohne Anker, getrieben von Wind und Wellen. Doch auch wenn ich es nicht sah – Gott ließ mich nicht los. Er führte mich durch diese dunklen Tage, um mir später zu zeigen, dass meine wahre Heimat nicht in einem Land dieser Erde liegt, sondern in Ihm Selbst.
Eines Tages geschah es wieder. Ich wurde in der Schule erneut als »Russe« verspottet. Die alte Wut brach sich Bahn, und ich sagte zu einem jener spottenden Klassenkameraden: »Warte nur! Nach der letzten Unterrichtsstunde klären wir die Sache, hinter der Schule!«
Das sprach sich schon bald herum, und als die letzte Stunde vorüber war, sammelte sich eine große Menge Schüler hinter der Schule. Alle warteten gespannt darauf, was jetzt geschehen würde. Spott und Lästereien flogen mir entgegen, ein Junge reizte mich besonders. Schließlich verlor ich die Kontrolle und stürzte mich auf ihn. All die aufgestaute Bitterkeit entlud sich in Form von Aggression. Es entstand ein Tumult. Erst als ältere Schüler dazwischentraten, konnten wir uns trennen.
Am nächsten Tag sprach die ganze Schule davon. Mein Mitschüler musste einige Tage lang zu Hause bleiben, bevor er zurückkehrte. Als er wieder kam, entschuldigte er sich sogar bei mir. Und plötzlich erlebte ich das, was ich mir so lange ersehnt hatte: Respekt. In meiner Klasse – ja, in der ganzen Schule – galt ich nun als jemand, mit dem man sich besser nicht anlegt.
Doch innerlich war alles anders. Während äußerlich mein Ansehen stieg, wurde mein Herz leerer. Statt Frieden und Freude spürte ich nur noch größere Entfernung von Gott. Ich hatte äußerlich Respekt gewonnen, doch innerlich verlor ich den Halt. Ich war wie der verlorene Sohn: nach außen frei und stark, in Wahrheit aber versank ich immer tiefer im Elend (vgl. Lk. 15,11-16).
Inzwischen hatte ich in der Schule einen guten Draht zu einigen Lehrern und auch zum Schulleiter gefunden. Auch in meiner Klasse gewann ich mehr Freunde. Doch am Lernen selbst hatte ich wenig Interesse. Die einzigen Fächer, die mich noch faszinierten, waren Sport und Technik. So schleppte ich mich mühsam durch die Schulzeit und erreichte mit Ach und Krach den Hauptschulabschluss.
Nach dem Schulabschluss begann ich eine Ausbildung zum Holzmechaniker. Diese Entscheidung war auch durch unsere Familientradition geprägt, denn sowohl mein Großvater als auch mein Vater waren Tischler. Schon seit meiner Kindheit hatte ich Freude daran, mit Holz zu arbeiten. Die Möglichkeit, mit den eigenen Händen etwas zu schaffen, faszinierte mich. So fand ich beruflich meinen Platz im Handwerk.
Auch wenn mein Leben nach außen hin weiterlief, war mein Herz innerlich weit von Gott entfernt. Meine Eltern sahen es mit Sorge. Sie entdeckten, dass mich die Welt im Umgang mit meinen Freunden, in meiner Freizeit mehr und mehr fesselte; mein ganzes Denken veränderte sich. Dem Glauben gegenüber, der einst mein Elternhaus prägte, war ich innerlich kalt geworden.
Ich suchte meine Erfüllung immer mehr im Sport, auch im Kampfsport, sodass dieser zunehmend mein Leben bestimmte. Ich wollte stark sein, unantastbar, jemand, den man fürchtet und respektiert. Doch hinter dieser Fassade brodelte etwas Gefährliches: Hochmut, Aggression und Wut. Manchmal erschrak ich selbst über die Frage: Wozu wäre ich fähig, wenn ich die Kontrolle über mich selbst ganz verlieren würde?
Mit 16 meldete ich mich beim Militär – mein großer Traum war es, Marineoffizier oder Kampfpilot zu werden. Von meinem 14. bis zum 22. Lebensjahr wohnten wir direkt neben einer großen Militärbasis. Ich sah fast täglich Soldaten in ihrer Ausbildung. Manchmal beobachtete ich ihre Schießübungen auf dem Übungsplatz, zu dem ich eigentlich keinen Zutritt hatte. Ich sah Panzer rollen und Jets über unsere Häuser donnern. Diese Welt übte eine gewaltige Faszination auf mich aus. Für mich bedeutete sie Stärke, Disziplin, Respekt – alles, wonach ich mich sehnte.
Was ich jedoch damals nicht erkannte, war, dass ich meine Identität, meinen Wert und meinen Frieden an den falschen Orten suchte. Ich hoffte, durch äußere Stärke meinen inneren Schmerz zu überwinden. Aber die Schrift sagt, mit anderen Worten: »Nicht der Starke siegt, und nicht der Held gewinnt den Kampf, sondern ›der Kampf ist die Sache des Herrn‹ (vgl. 1.Sam. 17,47).« Erst viel später sollte ich erkennen, dass wahre Stärke allein in Christus zu finden ist.
Jugendzeit: Doppelleben und Gottes Reden
Da ich nicht völlig in der Welt aufgehen wollte, aber auch die Freunde in der Gemeinde nicht verlieren wollte, fasste ich einen Entschluss: Ich meldete mich zur Taufe – allerdings ohne wirkliche Buße, ohne eine echte Veränderung meines Herzens erlebt zu haben.
So wurde ich mit 17 Jahren Mitglied einer Baptistengemeinde. Nach außen wirkte es wie ein klarer Glaubensschritt, doch innerlich war alles hohl und leer. Ich hatte keinen Frieden mit Gott, keine Gewissheit der Vergebung, keine Freude in Christus. Stattdessen blieb in mir eine tiefe Leere zurück.
Damals wusste ich nichts von echter Sündenerkenntnis, nichts von meiner völligen Verdorbenheit vor einem heiligen Gott. Ich hatte nicht verstanden, was Paulus schreibt: »Es ist keiner gerecht, auch nicht einer; es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt« (Röm. 3,10-11). Ich dachte, es reiche, wenn ich den äußerlichen Schritt der Glaubenstaufe ging, wenn ich mich anpasste und dadurch in der Gemeinde anerkannt wurde.
Im Grunde wollte ich nichts anderes, als mein Gewissen zu beruhigen und mir einen Platz unter den Christen zu sichern. Aber in meinem Herzen war ich wie die Pharisäer, von denen Jesus sagt: »Dieses Volk naht sich zu Mir mit seinem Mund und ehrt Mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von Mir« (Mt. 15,8).
So lebte ich äußerlich als Gemeindemitglied, aber innerlich blieb ich ein Fremder gegenüber Gott. Ich täuschte andere und am meisten mich selbst: Ich war überzeugt, ein Christ zu sein, und doch fehlte mir innerlich das Leben, das Christus Selbst ist – das ewige Leben.
Darum wurde es nach meiner Taufe nicht besser mit mir, sondern eher schlimmer. Ich führte ein Doppelleben: nach außen der fromme Christ, in Wirklichkeit aber ein Heuchler. Ich wusste genau, wie man als Christ redet, wie man sich verhält und den Schein wahrt, und doch war mein Herz weit weg von Gott. Jesus Selbst hatte die Pharisäer so bezeichnet, und diese Worte trafen auch auf mich zu: »Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun!« (Joh. 8,44). Das war die bittere Wahrheit: Ich nannte mich Christ, aber in Wirklichkeit war ich ein Kind des Teufels.
Schon während der Schulzeit suchte ich bei andern Anerkennung durch Musik. Mit Freunden zusammen gründeten wir eine Band und genossen es, durch Auftritte Beifall zu erlangen. Bald kam mir der Gedanke: Warum nicht auch in der Gemeinde punkten – besonders bei den Jugendlichen –, indem ich moderne Musik einbringe?
Allerdings schob die Gemeindeleitung meinen Plänen schnell einen Riegel vor. Für mich war das ein harter Schlag. Entmutigt und zurückgewiesen, fühlte ich mich wieder einmal ohne Sinn und Ziel. Alles, was ich mir aufzubauen suchte, schien zu zerbrechen.
Damals sah ich nur Niederlagen, Frust und verschlossene Türen. Erst später verstand ich: Es war Gott Selbst, der in dieser Weise an meinem Herzen zu arbeiten begann – nicht durch Erfolge, sondern durch Rückschläge.
Eines Tages nahm mich mein Vater ernsthaft zur Seite: »Mein Sohn, verstehst du, was Gott dir damit sagen will?« Verwundert fragte ich: »Wie? Etwa dadurch, dass mir so vieles misslingt?« Er nickte und antwortete: »Ja. Manchmal muss Gott uns etwas wegnehmen oder uns Schmerzen zufügen, damit wir anfangen, wirklich nach Ihm zu suchen.«
Diese Worte trafen mich zutiefst. Zum ersten Mal ahnte ich: Vielleicht sind all meine Niederlagen kein Zufall, sondern Gnade. Vielleicht gebraucht Gott mein Scheitern, um mich zu sich zu ziehen. In Hosea 2,8 heißt es diesbezüglich: »Ich will deinen Weg mit Dornen verzäunen«. Gott begann, meinen Weg zu versperren – nicht, um mich zu zerstören, sondern um mich zu sich zu ziehen.
Ein neues Leben in Christus
Ich war 19 Jahre alt und gefangen zwischen zwei Welten: Nach außen hin war ich Gemeindemitglied, innerlich steckte ich jedoch mitten in der Welt. Ich war nicht wiedergeboren, hatte keinen Frieden mit Gott und führte ein Leben voller Heuchelei. Die Last meiner Schuld drückte schwer auf meinem Gewissen, und je länger ich so lebte, desto klarer spürte ich: So konnte es nicht weitergehen.
In meiner inneren Not griff ich wieder zur Bibel. Oft ging ich allein in den Wald, setzte mich auf einen Baumstamm oder wanderte stundenlang umher. Dort weinte und betete ich, rang mit Gott, bat um ein neues Leben. Ich war müde geworden – müde von meinem Doppelleben, vom Versteckspiel, von meiner Scheinheiligkeit und inneren Leere. In meinem Herzen wuchs eine tiefe Sehnsucht nach Befreiung.
Wie lange dieser Kampf dauerte, weiß ich nicht. Aber nach und nach geschah etwas Wunderbares: Gottes Wort begann mein Herz zu durchdringen. Der Friede, den die Welt nicht geben kann (Joh. 14,27), zog in mein Inneres ein. Ich durfte die Gewissheit erlangen: Christus hat auch meine Sünden getragen. Die Last, die mich so lange erdrückt hatte, fiel von mir ab. Zum ersten Mal verstand ich, was es heißt: »So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind« (Röm. 8,1).
Ein neuer Hunger nach Gottes Wort ergriff mich. Ich konnte kaum noch aufhören, die Bibel zu lesen. Und eine nie gekannte Liebe brannte in meinem Herzen: Liebe zu Jesus und zu den verlorenen Menschen, die Christus nicht kannten. Jeder Gottesdienst wurde mir zur Freude, die Gemeinde zur geistlichen Familie. Die alten Freunde wandten sich von mir ab, mit der Begründung: »Du bist uns zu fromm, ja richtig langweilig geworden«. Aber der Herr schenkte mir neue, tiefere Freundschaften – Freundschaften, die auf Christus gegründet sind.
Selbst die Musik, die früher für mich nur ein Mittel zur Selbstdarstellung war, bekam eine neue Bedeutung: Sie wurde Ausdruck von Anbetung. Geistliche Lieder bewegten nun mein Herz, weil ich den Herrn von Herzen preisen und anbeten wollte.
Mein ganzes Leben hatte sich verändert und die Menschen um mich herum bemerkten es. Meine Familie freute sich mit mir und dankte Gott für Sein Wirken. Auch in der Gemeinde wurde meine Veränderung erkannt, und viele waren dadurch ermutigt. Sogar meine Arbeitskollegen fragten mich: »Was ist mit dir geschehen?« Da durfte ich ihnen von Jesus erzählen, dem Retter, der mir neues Leben geschenkt hatte. Ja, nun war es eine Freude, ihnen das Evangelium mitzuteilen.
Endlich wusste ich, was wahre Vergebung ist. Endlich erlebte ich Freude und Frieden – nicht als äußere Fassade, sondern als inneres Werk des Heiligen Geistes. Ich durfte von Herzen bekennen: »Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu geworden!« (2.Kor. 5,17).
Schon kurze Zeit nach meiner Bekehrung begann ich, mich in der Jugendarbeit zu engagieren. Es war mein Herzensanliegen, jungen Menschen geistliche Orientierung zu geben. Besonders die Musik lag mir am Herzen. Durch Gottes Gnade hatte ich ein neues Verständnis dafür gewonnen, was wirklich das Wesen geistlicher Lieder ist: Sie dienen nicht zur Unterhaltung, sondern zur Anbetung. Ich wollte sie fördern und nutzen, um Christus in der Gemeinde zu verherrlichen und andere für Ihn zu gewinnen.
Bald durfte ich auch Bibelarbeiten in der Jugend halten und immer mehr Verantwortung übernehmen. Nach etwa sechs Monaten geschah etwas, das ich mir bis heute kaum erklären kann: Ich hielt meine erste Predigt – vor mehreren hundert Menschen in der Gemeinde. Ich war völlig unerfahren, hatte kaum Bibelkenntnisse und sicher noch keine geistliche Reife.
Der Text, den ich damals zum »Predigen« nahm, war Esra 10,1-4 – ein Aufruf zur Buße. Er hatte mich selbst tief bewegt, und mit derselben Ernsthaftigkeit rief ich alle Christen, die lau geworden waren, zur Buße auf. Manche wurden durch diese Predigt sehr nachdenklich, und einige bezeugten, dass Gott Selbst in diesen Worten zu ihnen gesprochen habe.
Nach einiger Zeit entschloss sich die Gemeindeleitung, mich und einige andere junge Brüder aufgrund unserer musikalischen Fähigkeiten zu einem Dirigentenseminar zu schicken, weil sie die geistliche Musik in der Gemeinde zu fördern suchte. Ich war dankbar für diese Förderung und lernte dabei viel über Chorleitung, geistliche Tiefe sowie die Verantwortung, Musik nicht als Selbstzweck zu verstehen, sondern als Form der Anbetung.
Darüber hinaus durfte ich mich bald auch in Evangelisationen und Missionseinsätzen einbringen. Regelmäßig reisten wir in die ehemalige DDR, um vor allem den sowjetischen Soldaten und Offizieren das Evangelium zu bringen. Zusätzlich besuchten wir Gefängnisse, brachten den Insassen Schriften und erzählten ihnen von der Hoffnung in Christus. Ich durfte auch in Ausländerwohnheimen Hoffnung suchenden Menschen Christus nahebringen. Meine Verkündigung war damals sicher noch recht oberflächlich; doch Gott gebrauchte sie, um in Menschen den Wunsch zu wecken, den Gottesdienst zu besuchen und um sie mit Seinem Wort in Berührung zu bringen.
Dabei durfte ich immer wieder erleben, wie Menschen durch das Evangelium zum Glauben kamen und der Gemeinde hinzugefügt wurden. Mit eigenen Augen sah ich, wie sich die Verheißung Gottes erfüllte: »Genau so soll auch Mein Wort sein, das aus Meinem Mund hervorgeht: Es wird nicht leer zu Mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was Mir gefällt, und durchführen, wozu Ich es gesandt habe!« (Jes. 55,11).
Dieser Dienst schenkte mir eine unbeschreibliche Freude und bestärkte mich in der Überzeugung: Es gibt nichts Herrlicheres, als Christus zu dienen und Zeuge Seines Evangeliums zu sein.
Lektionen im Zivildienst
Nachdem ich Christ geworden war, legte ich vorläufig den Wunsch, zum Militär zu gehen, beiseite. Als es jedoch zur Musterung für den Wehrdienst kam, stellte ich einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung. Ich konnte es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, den Militärdienst anzutreten. Stattdessen bat ich darum, Zivildienst leisten zu dürfen – in der Überzeugung, dass mein Leben dem Dienst für Christus und nicht der Waffe gehören sollte.
So trat ich meinen 13-monatigen Zivildienst in Bethel (Bielefeld) an. Dort begegnete ich einer ganz anderen Welt, als ich sie bisher gekannt hatte: Ich sah lauter Menschen mit Behinderungen, Krankheiten und großen Einschränkungen. Für mich wurde dies zu einer Schule der Demut, Geduld und praktischen Liebe. Ich lernte, dass Nachfolge nicht nur im Predigen und Evangelisieren besteht, sondern auch darin, anderen im Alltag zu dienen. »Denn auch [Christus] ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und Sein Leben zu geben als Lösegeld für viele« (Mk. 10,45).
Nach der Absolvierung meines Zivildienstes blieb ich noch zwei Jahre in Bethel. Rückblickend erkenne ich, wie sehr diese Zeit mein Leben geprägt hat. Gott lehrte mich, nicht meinen eigenen Ambitionen nachzujagen, sondern auch in kleinen Dingen treu zu sein. Ich durfte Menschen ein Stück weit mit den Augen Jesu sehen lernen – sie nicht nach ihrer Stärke oder Schwäche zu beurteilen, sondern sie als von Gott geliebte Geschöpfe anzusehen, die Hoffnung und vor allem das Evangelium brauchen.
Diese Jahre in Bethel waren für mich eine wertvolle Vorbereitung. Gott gebrauchte sie, um mein Herz zu formen, meinen Charakter zu schärfen und mir zu zeigen: Wahrer Dienst beginnt dort, wo man sich für andere hingibt – auch in scheinbar unscheinbaren Aufgaben.
Ehe, Familie und zunehmender Dienst
Mit 22 Jahren durfte ich die Liebe meines Lebens heiraten – meine Frau Lisa. In Seiner Gnade hat der Herr uns mit zehn wunderbaren Kindern und inzwischen sieben Enkelkindern beschenkt. Von Anfang an war es unser gemeinsames Anliegen, unser Leben in den Dienst Gottes zu stellen und Ihm als Familie nachzufolgen.
Da ich schon zuvor viele Aufgaben in der Gemeinde übernommen hatte, setzten wir diesen Weg nun gemeinsam fort. Meine Verantwortung wuchs: Evangelisation, Musikarbeit, Predigen und vieles mehr bestimmten mein Leben. Von außen wirkte es, als sei ich voller Eifer für den Herrn unterwegs. Doch innerlich begann sich etwas zu verändern.
Die Fülle der Aufgaben ließ mir kaum noch Raum für die Pflege tiefer Gemeinschaft mit dem Herrn. Oft vertiefte ich mich nur dann ins Bibelstudium, wenn eine Predigt vorbereitet werden musste. Immer mehr wurde mein Dienst zu einer Art Aktivismus − äußerlich wirkte ich fleißig, aber es geschah alles ohne rechte Herzenshingabe. Doch der Herr sieht nicht nur die äußerliche Aktivität, sondern auch das Herz.
Mit der Zeit bemerkte ich, wie die Freude am Herrn schwand. Routine, Pflichtgefühl und der Druck, Erwartungen erfüllen zu müssen, verdrängten die erste Liebe zu Christus. Und wo diese Liebe fehlt, wird man gleichgültig, träge und anfällig für Sünde. Menschlicher Eifer mag für eine Zeit lang wirken – doch ohne die Führung des Geistes Gottes bleibt der Dienst leer, schwer und letztlich wirkungslos.
In dieser Phase geistlicher Lauheit demütigte mich der Herr besonders. Er ließ mich erkennen, dass ich mich auf meine Werke stützte, statt aus Seiner Gnade und im Vertrauen auf Ihn zu leben. Neu wurde mir Jesu Wort an die Gemeinde in Laodizea bewusst: »Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist … So aber, weil du lau bist, …« (Off. 3,15-16). Doch gerade in dieser Schwachheit zeigte mir Gott Seine Barmherzigkeit. Er führte mich zurück zur Quelle – zu Christus Selbst. Ich durfte erkennen, dass wahre Frucht im Dienst nicht aus meiner Anstrengung erwächst, sondern aus dem Bleiben in Ihm, wie Jesus sagt: »Wer in Mir bleibt und Ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn getrennt von Mir könnt ihr nichts tun« (Joh. 15,5).
In dieser Zeit hatte ich eine bemerkenswerte Begegnung. Lisa und ich flogen mit zwei unserer Kinder nach Sibirien, wo ich aufgewachsen bin, um meinen Bruder und die Gemeinde dort zu besuchen. Nach einem Gottesdienst kam meine ehemalige Lehrerin auf mich zu – diejenige, die mir früher oft das Leben schwer gemacht hatte, mich aber am Ende freundlich verabschiedete mit den Worten: »Denke an mich.« Nun erzählte sie mir, dass der Herr sie errettet habe. Bewegt bat sie mich um Vergebung für all das, was sie mir damals angetan hatte, und bezeugte: »Ich bin jetzt auch eine Christin.« Eine einst überzeugte Kommunistin war nun eine Nachfolgerin Jesu. Wie groß ist Gottes Gnade! Wie mächtig ist Sein Wirken!
Hunger nach Gottes Wort
Inzwischen hatte der Herr uns mit sieben Kindern gesegnet. Mit wachsender Familie stiegen jedoch auch die Herausforderungen. Die Verantwortung, für alle zu sorgen, lastete schwer auf mir. Hinzu kamen gesundheitliche Probleme. Deshalb begann ich eine Umschulung zum Technischen Zeichner (Konstrukteur) im Maschinenbau – in der Hoffnung auf eine sichere Karriere und ein besseres Einkommen.
Von außen erschien dieser Schritt vernünftig. Doch innerlich geschah etwas Gefährliches: Mein Vertrauen richtete sich immer weniger auf Christus und immer mehr auf vergängliche Dinge. Meine Prioritäten verschoben sich. Anstatt zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten (Mt. 6,33), ließ ich mich vom Drang nach beruflichem Vorankommen und materieller Sicherheit bestimmen.
Allmählich wurde mein Herz kälter. Die Leidenschaft für Gottes Wort und die Freude im Dienst verblassten. Ich wurde von den Sorgen dieses Lebens eingefangen, und es geschah genau das, was Jesus im Gleichnis vom Sämann beschreibt: »Die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar« (Mt. 13,22). Genauso erging es mir. Schritt für Schritt verlor ich die geistliche Orientierung.
Doch in Seiner unendlichen Gnade ließ der Herr mich nicht in dieser geistlichen Oberflächlichkeit stecken. Er begann erneut, an meinem Herzen zu wirken. Langsam, aber beständig weckte Er in mir eine neue Sehnsucht nach Seinem Wort. Ich vertiefte mich wieder intensiver in der Bibel und begann auch, geistliche Literatur zu lesen.
Besonders Biografien großer Männer Gottes begannen mich zu prägen. Immer stärker wuchs das Verlangen, mein Leben ganz Christus zu weihen. Ein Ältester unserer Gemeinde gab mir schließlich ein Buch, das mein Denken tiefgreifend veränderte: »Alles zur Ehre Gottes«, die Biografie von Charles Haddon Spurgeon. Seine Hingabe, seine Liebe zu Christus und sein unerschütterliches Vertrauen auf die Gnade Gottes trafen mich mitten ins Herz.
So begann ich, mich immer mehr mit Spurgeons Predigten und Schriften zu beschäftigen. Je mehr ich las, desto größer wurde mein Hunger nach klarer biblischer Wahrheit. Ich wollte Christus tiefer erkennen, in der Heiligung wachsen und ein Leben führen, das Ihm allein gehört. Dabei erkannte ich, wie oberflächlich mein Herz bis dahin gewesen war. Ich hatte mich schon lange Zeit Christ genannt, ohne aber die Tiefe meiner Sündhaftigkeit, die Größe meiner Schuld und die Herrlichkeit des Kreuzes wirklich begriffen zu haben.
Jetzt durfte ich immer mehr verstehen, dass ich in Christus für all meine Schuld völlige Vergebung habe. In Ihm bin ich vor Gott vollkommen gerechtfertigt. Mein Heil beruht nicht auf meinem Tun, nicht auf meinem Dienst, nicht auf meiner Leistung – sondern allein auf dem vollbrachten Werk Jesu Christi. »Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch – Gottes Gabe ist es; nicht aus Werken, damit niemand sich rühme« (Eph. 2,8-9).
Diese Wahrheit begann mein Herz zu erleuchten. Mir wurde klar: Bis dahin hatte ich nur die Grundelemente des Evangeliums erfasst, es war ein Verständnis, das kaum über das eines Kindes hinausging. Doch jetzt öffnete der Herr mir die Augen für die Tiefe und Fülle des Evangeliums. Es war, als ob ein neuer Tag in meinem Leben anbrach.
Berufung in den vollzeitlichen Dienst
Ich stand nun an einem entscheidenden Wendepunkt, vor einem echten Dilemma. Mehrere Türen öffneten sich gleichzeitig, mit einer vielversprechenden Zukunft, mit Anerkennung und Sicherheit. Auf der einen Seite stand mein neuer Beruf als Technischer Zeichner. Hier boten sich mir sichere Möglichkeiten, gutes Geld zu verdienen und meiner wachsenden Familie Stabilität zu geben – menschlich gesehen eine verantwortungsvolle Option.
Auf der anderen Seite lag die Arbeit mit Musik. Ich hatte über Jahre hinweg intensiven Unterricht in den Fächern Cello, Harmonielehre, Komposition, Gesang und Dirigieren genommen. Auch hier eröffneten sich Möglichkeiten, eine musikalische Laufbahn einzuschlagen, was meinem Herzen ohnehin sehr nahe lag. Schließlich hatte ich dafür so viel Zeit und Geld investiert.
Doch über alledem wuchs ein noch stärkeres Verlangen: mein Leben ganz Christus zu weihen und Ihm in völliger Abhängigkeit von Ihm zu dienen. Und bald stand auch eine konkrete Einladung zu einem vollzeitlichen Missionsdienst im Raum.
Was sollte ich tun? Wohin wollte der Herr mich führen? Mein Herz war hin- und hergerissen zwischen diesen Möglichkeiten.
So suchten meine Frau und ich intensiv den Herrn im Gebet. Immer wieder knieten wir gemeinsam nieder und fragten: »Herr, was willst Du, dass wir tun sollen? Wo willst Du uns gebrauchen? Zeige uns Deinen Weg.« Auch unseren Eltern und den Ältesten unserer Gemeinde legten wir diese Situation offen dar. Wir wollten nicht eigenmächtig entscheiden, sondern suchten bewusst den Rat gottesfürchtiger Menschen. Wir vertrauten darauf, dass der Herr uns durch Sein Wort, durch Gebet und durch die Weisheit von anderen Gläubigen den richtigen Weg zeigen würde.
In dieser Zeit wurde mir das Wort aus Sprüche 3,5-6 neu kostbar: »Vertraue auf den HERRN von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand; erkenne Ihn auf allen deinen Wegen, so wird Er deine Pfade ebnen.«
Während wir um klare Führung baten, begann der Herr bereits, uns durch konkrete Aufgaben eine Richtung zu zeigen. Immer mehr Verantwortung kam auf mich zu – nicht nur in unserer Gemeinde, sondern auch darüber hinaus. Ich wurde eingeladen zu predigen und Vorträge zu halten, durfte Dirigentenseminare geben, Chöre und Orchester leiten, Noten schreiben und Liederbücher herausgeben. Hinzu kam die Mitarbeit bei Missionskonferenzen, die Leitung von CD-Aufnahmen und zahlreiche Einsätze in evangelistischer Tätigkeit.
Diese Aufgaben wuchsen mir nicht einfach über den Kopf – sie machten mir vielmehr deutlich: Der Herr gebraucht dich. Nicht deine Fähigkeiten oder Pläne sind entscheidend, sondern Seine Gnade, die in der Schwachheit vollkommen wird (2.Kor. 12,9). Schritt für Schritt erkannte ich: Mein Platz soll weder in beruflicher Karriere liegen noch in der musikalischen Laufbahn, sondern im Dienst am Wort Gottes, an Seiner Gemeinde und an der Ausbreitung des Evangeliums.
Gleichzeitig führte mich dies in eine tiefe Abhängigkeit vom Herrn. Oft fühlte ich mich schwach, überfordert und unzureichend. Doch gerade darin durfte ich lernen: Gott beruft nicht die Starken, sondern die Schwachen, damit offenbar wird, dass die Herrlichkeit allein Ihm gebührt.
So begann also ein neuer Abschnitt: ein Leben im Dienst für Christus – getragen von Seiner Gnade, geleitet von Seiner Vorsehung, zur Verherrlichung Seines Namens.
So führte der Herr es, dass ich im Jahr 2005 offiziell in den vollzeitlichen Missionsdienst ausgesandt wurde. Für uns als Familie bedeutete dies große Veränderungen, denn damit war ein Umzug verbunden. Im Januar 2007 zogen wir schließlich mit unseren damals acht Kindern ins Oberbergische in NRW.
Theologische Prägung und Wachstum
In dieser Zeit wuchs in mir ein immer größerer Hunger nach dem Wort Gottes. Je mehr ich selbst im Dienst stand, desto stärker erkannte ich: Ich brauche klare, unumstößliche Antworten auf die Fragen meines Herzens. Doch wenn ich leitenden Brüdern gegenüber diese Fragen stellte, erhielt ich oft nur oberflächliche Reaktionen: »Niko, hör auf zu grübeln!« Solche Antworten stillten meinen Hunger nicht – im Gegenteil, sie machten mich nur unruhiger.
So begann ich, intensiver zu forschen: Ich vertiefte mich in die Schrift, griff zu geistlichen Büchern und betete um Erkenntnis. Dabei wuchs in mir ein Verlangen nach gesunder biblischer Lehre, die fest im Wort Gottes gegründet ist. Ich wollte mich nicht mit oberflächlichen Antworten zufriedengeben, sondern tiefer in der Wahrheit des Evangeliums gegründet werden.
Gerade diese Jahre gebrauchte der Herr, um mich nicht nur im praktischen Dienst, sondern auch im Verständnis Seines Wortes zu schulen. Es war, als hätte Er in mir einen Hunger geweckt, den nur Er Selbst stillen konnte – durch Sein lebendiges Wort (Mt. 4,4).
Je größer mein Hunger nach Gottes Wort wurde, desto mehr griff ich auch zu Biografien und theologischen Büchern. Ich wollte verstehen, wie Männer Gottes in früheren Zeiten geglaubt, gelebt und gedient hatten. So entdeckte ich die Schriften der Puritaner. Mit erstaunlicher Klarheit und Tiefe sprachen sie von Sünde, Gnade, Buße und Heiligung. Ihre Schriften trafen mein Herz, weil sie den ganzen Menschen erfassten – nach Verstand, Herz und Willen – und alles konsequent auf Christus ausrichteten.
Ebenso prägten mich die Predigten und Bücher von John MacArthur, der mit großer Treue und Klarheit die Schrift auslegte. Auch halfen mir die Schriften von R.C. Sproul, systematisch und theologisch zu denken, während die Predigten von Martyn Lloyd-Jones mir das Evangelium in einer Kraft und Lebendigkeit vor Augen stellten, wie ich es niemals zuvor gehört hatte.
Durch all diese Männer wurde mir immer deutlicher: Wahres Christsein ist nicht oberflächlich, sondern tief im Wort Gottes gegründet. Echtes Gemeindeleben baut sich nicht auf Traditionen oder menschliche Methoden, sondern auf die gesunde Lehre, die allein imstande ist, Christus zu verherrlichen.
So begann für mich eine neue Phase des Lebens. Ich wollte nicht nur dienen, sondern lernen. Ich wollte tiefer in die Schrift hineinwachsen, damit mein Dienst sich nicht auf meine eigene Kraft gründet, sondern aus dem Reichtum der Wahrheiten Gottes schöpft. Der Apostel Paulus schreibt: »Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit« (Kol. 3,16). Genau danach sehnte sich mein Herz.
Diese neuen Erkenntnisse blieben nicht ohne Folgen. Je mehr ich las, forschte und die Schrift studierte, desto tiefer veränderte sich mein Denken, insbesondere in lehrmäßigen Fragen. Die reformierte Lehre, die Lehre der Puritaner, wurde mir immer wertvoller, weil sie die biblische Wahrheit über Gottes Souveränität, Seine Gnade und Seine Herrlichkeit sowie die Verantwortung des Menschen darlegt.
Ich begann, das Evangelium tiefer zu begreifen – nicht nur als Botschaft für Verlorene, sondern als tägliche Nahrung für mein geistliches Leben. Ich staunte immer mehr über die unverdiente Güte und Gnade Gottes mir gegenüber. Alles, was ich bin und habe, alles, was in meinem Leben als Frucht hervorgebracht wird, ist allein Seiner Barmherzigkeit zu verdanken.
Dabei wurde mir auch meine Neigung zur Gesetzlichkeit bewusst. Wie oft war doch bisher mein Dienst von Aktivismus geprägt worden, als ginge es darum, mir etwas bei Gott zu verdienen! Statt im Glauben auf Christus zu schauen, hatte ich auf meine Anstrengungen vertraut.
Auch die menschenzentrierte Verkündigung, die ich oft gehört – und manchmal selbst praktiziert – hatte, wurde mir zunehmend fragwürdig. Ich erkannte: Wahrhaft biblische Predigt stellt nicht den Menschen ins Zentrum, sondern Christus. Es geht nicht darum, dass die Zuhörer sich wohlfühlen, sondern dass sie den Herrn erkennen und ein Leben zu führen lernen, das Gott verherrlicht. So begann ein inneres Ringen: Ich war erfüllt von Freude über das, was Gott mir durch Sein Wort zeigte und zugleich erfuhr ich die Spannung, dass diese Überzeugungen nicht überall willkommen waren. Doch ich wusste: Der Herr Selbst führt mich, und allein auf Ihn darf ich mein Vertrauen setzen.
Gründung von Voice of Hope
Im Jahr 2008 geschah etwas, das mein Leben und meinen Dienst nachhaltig prägen sollte: Das Missionswerk Voice of Hope wurde gegründet – und ich durfte von Anfang an daran teilhaben. Schon der Name war für mich ein starkes Zeugnis: Voice of Hope – das heißt »Stimme der Hoffnung«. Denn genau das braucht unsere Welt, die von Verzweiflung, Orientierungslosigkeit und Finsternis durchdrungen ist.
Von Beginn an war es mein tiefes Anliegen, durch dieses Werk die rettende Botschaft von Jesus Christus klar und unverfälscht weiterzugeben. Nicht menschliche Methoden oder oberflächliche Programme sollten uns leiten, sondern das lebendige und kraftvolle Evangelium. Ich durfte miterleben, wie Gott in Seiner Gnade Türen für das Evangelium öffnete, Gelegenheiten schenkte und Menschenherzen errettete – oft auf eine Weise, von der wir nicht einmal zu träumen wagten.
Rückblickend erkenne ich: Die Gründung von Voice of Hope war kein Zufall, sondern Teil von Gottes souveränem Handeln. Er schenkte alles – Menschen, eine klare Vision, Möglichkeiten –, und Er stellte mich trotz meiner Schwachheit in diesen Dienst. Wie Paulus schreibt: »Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns« (2.Kor. 4,7). Genau das durfte ich erfahren: Nicht wir, sondern Christus Selbst bringt durch Sein Wort Hoffnung in die Herzen der Menschen.
Dankbarer Rückblick
Nun blicke ich dankbar zurück: Vor zwanzig Jahren durfte ich in den vollzeitlichen Dienst treten. Gemeinsam mit meiner geliebten Frau Lisa sowie fast allen unseren Kindern und Schwiegerkindern dürfen wir unserem Herrn dienen. Was für ein unverdientes Vorrecht!
Doch das größte Geschenk liegt nicht allein im Dienst, sondern darin, jeden Tag neu aus der reichen Gnade Gottes leben zu dürfen. Alles, was geschieht, ist die Frucht Seiner Treue. Wir sind nur Werkzeuge in Seiner Hand – schwache Gefäße, die Er gebraucht, um die Größe Seiner Gnade sichtbar zu machen.
Ich staune immer wieder über die Wege, auf denen der Herr mich geführt hat. Manche waren von Dunkelheit überschattet – nicht selten durch mein eigenes Versagen –, andere waren geprägt von Prüfungen, die ich nicht verstehen konnte, und wieder andere waren reich an Freude, Trost und Segen. Doch zusammen offenbaren sie alle Seine Herrlichkeit. So ist das Wort des Apostels auch mein Bekenntnis geworden: »O welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind Seine Gerichte, und wie unausforschlich Seine Wege!« (Röm. 11,33).
Ja, Gottes Wege sind unergründlich – und doch herrlich. Darin liegt meine Ruhe, meine Freude und meine Hoffnung.
Seit dem Jahr 2016 darf ich gemeinsam mit anderen Brüdern in der Leitung der Reformierten Baptistengemeinde Reichshof dienen. Es ist eine große Freude und zugleich eine heilige Verantwortung, dort Sonntag für Sonntag das kraftvolle Evangelium zu verkündigen, Sünder zur Buße und zum Glauben zu rufen und gleichzeitig die Gemeinde Jesu in ihrem Glauben zu ermutigen und zu stärken. Unsere Gemeindearbeit ist eng mit dem Missionswerk Voice of Hope verbunden, denn wir sind überzeugt: Gemeinde und Mission gehören untrennbar zusammen.
Immer wieder dürfen wir erleben, wie der Herr Selbst Seine Gemeinde baut: Er schenkt geistliches Wachstum, ruft Menschen zum Glauben und gebraucht Sein lebendiges Wort, um zu ermutigen, zu korrigieren und zu stärken. Wie tröstlich ist es zu wissen: »So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt« (1.Kor. 3,7).
Auch persönlich haben wir allen Grund zur Dankbarkeit: für unsere zehn Kinder und die bis jetzt sieben Enkelkinder, die der Herr uns geschenkt hat. Ja, jedes einzelne ist ein Geschenk Seiner Gnade, ein sichtbares Zeichen Seiner Güte. Unser innigstes Gebet ist, dass sie alle den Herrn Jesus Christus von Herzen erkennen, Ihm nachfolgen und für ihre Generation lebendige Zeugen Seiner Wahrheit sind.
Schlusswort
In all den Jahren habe ich erfahren, dass der Weg mit Christus sowohl durch Höhen als auch durch Tiefen führt. Immer wieder zeigte mir der Herr, wie leicht mein Herz in den Hochmut abirrt, und doch hat Er mich in Seiner Liebe nie losgelassen, sondern mich immer wieder treu zur Buße und in die Gemeinschaft mit Ihm zurückgeführt. Andere Male erlebte ich, wie schnell man von einem Extrem ins andere geraten kann – von Gesetzlichkeit zu Gesetzlosigkeit, von Aktivismus zu Passivismus. Doch in alledem hat mich der Herr treu gelehrt, dass wir nicht auf Menschen oder unsere eigene Kraft vertrauen dürfen, sondern in allem ganz von Ihm abhängig sind. Und zugleich hat Er mir gezeigt, dass unser Herz und Leben, unser Denken und Handeln, unsere Zeit und alle anderen Ressourcen unter Seiner Herrschaft stehen sollen.
So durfte ich lernen, dass wahres Leben, wahrer Dienst und wahre Freude allein in Christus zu finden sind. Alles andere ist vergänglich – doch Sein Wort bleibt in Ewigkeit bestehen (Jes. 40,8), und in Ihm haben wir einen Schatz, der nie vergeht.
Darum ist es meine größte Leidenschaft und Hingabe, Christus tiefer zu erkennen und Sein Wort treu zu verkündigen. Mein Gebet ist, dass das Evangelium in unserem Land – und weit darüber hinaus – klar, unverfälscht und kraftvoll ausgebreitet wird. Denn allein die Botschaft vom gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus hat die Macht, Menschen zu retten, Gemeinden zu erneuern und ganze Gesellschaften zu verändern.
So schlägt mein Herz für den Herrn und Sein Wort, das allein Licht in die Finsternis bringt, Trost im Leid schenkt und eine lebendige Hoffnung für die Ewigkeit eröffnet.
Möge dieses Zeugnis einzig dazu dienen, die unermessliche Gnade Gottes zu rühmen – jene Gnade, die Er mir erwiesen hat und die mich bis heute trägt. Denn alles, was ich bin und habe, verdanke ich allein Seiner Güte und Treue.
Soli Deo Gloria – Gott allein sei die Ehre!

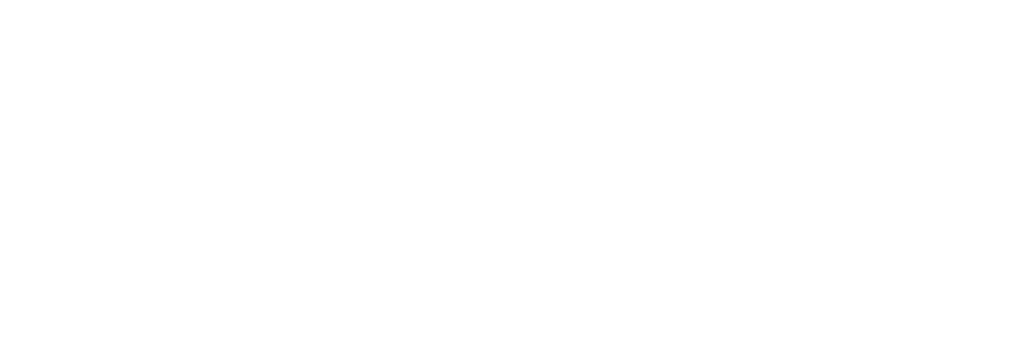
 Streaming Plattform
Streaming Plattform




